Unsere Forschungsbereiche stellen sich vor
Forschungsbereich Translation, Geschichte und Politik
Der Forschungsbereich Translation, Geschichte und Politik widmet sich der historischen Rekonstruktion und historisch hergeleiteten Interpretation translatorischer Praktiken, Translationspolitiken und Translationskultur. Unser Zugang verbindet die Geschichte der Translation mit einer Translationsgeschichte, einer transnationalen, transkulturellen und multilingualen Geschichtsschreibung. Translation verstehen wir demnach als ein geeignetes methodologisch-theoretisches Prisma für eine einschlägige allgemeine Historiographie.
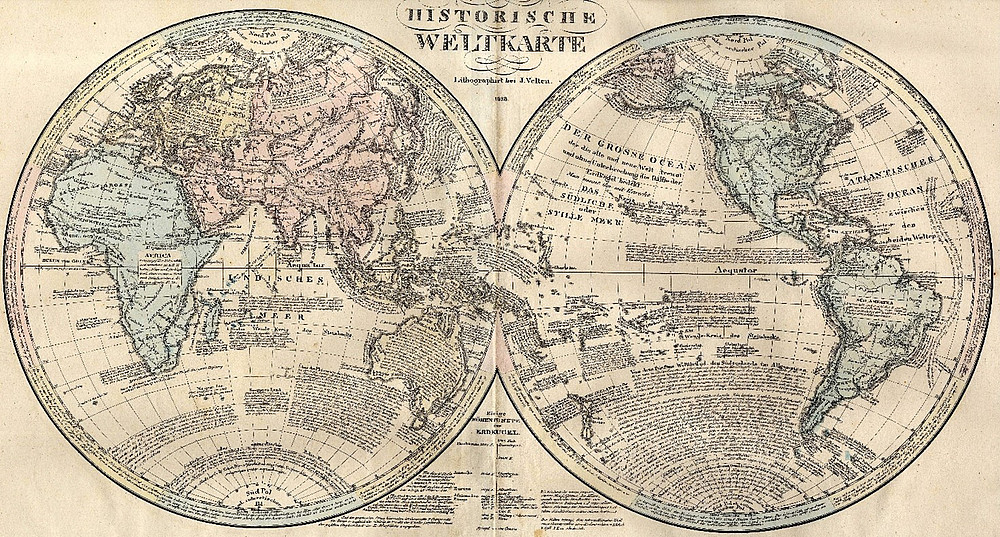
Außerdem weist die Rekonstruktion historischer Praktiken das Potenzial auf, zur stärkeren Historisierung der Translationswissenschaft beizutragen und stellt somit die vermeintliche Unschuld der Translation aus disziplinär-historischer Perspektive in Frage. Im Mittelpunkt stehen die involvierten Akteur:innen, als auch translatorische Impulse, welche zur Änderung ökonomischer, politischer, religiöser oder sozialer Machtverhältnisse führen. Zugleich stellt sich die Frage, wie Translation gesteuert wird, wie diese Steuerungsfaktoren zur Grenzziehung zwischen Translation und anderen transkulturellen Praktiken beitragen, aber auch wie historisch geprägte Translationskulturen zwischen variierenden ökonomischen, politischen, religiösen oder sozialen Anliegen und Machtansprüchen einem ständigen Wandel unterliegen.
Folgende Forschungsfragen beschäftigen uns:
- Wie wirken unterschiedliche Formen und Politiken der Translation in Zeiten sozialer, politischer, kultureller Umbrüche?
- Welchen Stellenwert nimmt Translation als historisch komplexen Praktik der transnationalen Wissensgestaltung und -transformation ein?
-
Wie lassen sich etablierte Konzeptualisierungen von Translation durch deren historische Untersuchung hinterfragen oder erweitern?

Forschungsbereich Translation, Migration und Minderheiten
Translation spielt eine zentrale Rolle bei der Begegnung von sprachlichen, sozialen und kulturellen Mehrheiten und Minderheiten. Wesentliche Merkmale unserer Forschung im Forschungsbereich Transation, Migration und Minderheiten sind: Orientierung an gesellschaftlichen Problemfeldern, emanzipatorischer Charakter und gesellschaftspolitischer Anspruch. Im Fokus unserer kultur- und sozialwissenschaftlich orientierten Forschung stehen Phänomene der Translation, die von asymmetrischen Machtverhältnissen sowie politischen, ideologischen, sozialen und kulturellen Barrieren geprägt sind.
Wir beforschen Translation in Geschichte und Gegenwart, professionelle und nichtprofessionelle, humane wie technologisch vermittelte Translation. Unsere Forschung ist inter- und transdisziplinär. Um unsere Forschungsergebnisse umzusetzen, kooperieren wir mit außeruniversitären Institutionen wie Behörden, NGOs, zwischenstaatlichen Organisationen und Interessensvertretungen. In diesem Zusammenhang sensibilisieren wir für die komplexen sozialen und kulturellen Zusammenhänge von Translation, entwickeln Curricula, erarbeiten Modelle und Maßnahmen zur Gestaltung der Rahmenbedingungen von Translation und zeigen Möglichkeiten zur Ausweitung der Handlungsspielräume der beteiligten Akteur:innen auf.
Folgende Forschungsfragen beschäftigen uns:
- Welche Rolle nimmt Translation in NGOs, bei Behörden, in der medizinisch-psychosozialen Versorgung von Migrant:innen und Gehörlosen, in Krisen- und Katastrophenräumen ein?
- Funktioniert die Dichotomie professionelles vs. nicht professionelles Dolmetschen im Kontext von Migration?
- Wie beeinflusst die Digitalisierung Translation im Kontext von Migration und Minderheiten?
- Welche Konzepte und Modelle aus anderen Disziplinen können wir für unsere Forschung nutzen, um die komplexen Rahmen- und Realisierungsbedingungen von Translation in der Lebenswelt von zugewanderten und einheimischen Minderheiten zu beforschen?
-
Welche neuen Forschungsansätze und -methoden werden unserem Forschungsfeld gerechter?
Forschungsbereich Translation, Ethik und digitaler Wandel
Der Forschungsbereich Translation, Ethik und Digitaler Wandel befasst sich kritisch mit den historischen Dimensionen und der gesellschaftspolitischen Relevanz von Sprach- und Translationstechnologien. Aus einer sozial- und kulturtheoretischen sowie empirischen Perspektive untersuchen wir verschiedenste Phänomene der digitalen Translation hinsichtlich ihrer ethischen, ideologischen, (geo)politischen, gesellschaftlichen, ökonomischen und medialen Wechselwirkungen.

Im Zentrum des Interesses stehen dabei sowohl das Verhältnis zwischen Translationstechnologien und Gesellschaft als auch multimodale und kooperative Formen der transkulturellen Kommunikation. Hierbei handelt es sich u.a. um Translationstechnologien wie maschinelles Übersetzen und Dolmetschen, automatische Spracherkennung und synthetische Sprachausgabe, multilinguale Chatbots und intelligente Sprachassistenten sowie photobasierte Translation-Apps und Gebärdensprach-Avatare. Von besonderem Interesse sind in diesem Zusammenhang pädagogische und didaktische Fragen hinsichtlich der Bildung und Ausbildung von Übersetzer:innen und Dolmetscher:innen als auch die individuellen und gesellschaftlichen Auswirkungen KI-basierter multilingualer Sprach- und Translationstechnologien.
Folgende Forschungsfragen beschäftigen uns:
- Wie verändert sich das Bild von und der Umgang mit Translation vor dem Hintergrund einer rasant zunehmenden Maschinisierung und Automatisierung von Übersetzungsprozessen?
- Welche Auswirkungen hat die stark steigende Verwendung von maschineller Übersetzung auf die Arbeitsweise, die wirtschaftliche Situation und den Status von professionellen Translator:innen?
- Inwieweit spiegelt der Output maschineller Übersetzungssysteme gesellschaftliche Stereotype (z.B. Geschlecht) wider und wie können Translationstechnologien inklusiver gemacht werden?
- Wie müssen sich translationswissenschaftliche Institute vor dem Hintergrund der Digitalisierung transformieren, um Studierenden auch in Zukunft eine moderne, nachhaltige und kritische Ausbildung bieten zu können?